
Kronleuchter aus der Ausstellung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung; Foto: Marta Gornicka
Immigration und Emigration: das ist die ganze europäische Geschichte
Ein Interview mit Michael Dorrmann, dem Ausstellungskurator, und Manfred Kittel, dem Gründungsdirektor der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Dieses Interview wurde von Daniel Miller geführt.
Daniel Miller: Können Sie den Unterschied zwischen dem Bund der Vertriebenen, dem Zentrum gegen Vertreibungen und der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung erläutern?
Manfred Kittel: Das Zentrum ist im Wesentlichen eine zivilgesellschaftliche Initiative zweier Personen: Von Erika Steinbach, der Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen und CDU-Abgeordneten, und von Peter Glotz, dem ehemaligen Generalsekretär der SPD. Es waren also Repräsentanten der beiden großen “Volksparteien” in Deutschland beteiligt, es war nicht nur das Projekt einer Partei. Es gab auch sehr viele prominente Unterstützer, Schriftsteller, Intellektuelle von beiden Seiten des politischen Spektrums. Doch dies ist die Vorgeschichte. Denn in 2008 hat der Bundestag unsere Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung als eine Bundesstiftung gegründet.
DM: Ist Erika Steinbach in Ihrem Stiftungsrat?
MK: Nein. Es gab eine heftige Diskussion über dieses Thema. Sechs der 21 Mitglieder unseres Stiftungsrates sind auch Mitglieder des Bundes der Vertriebenen. Erika Steinbach jedoch nicht. 2009 hat der deutsche Außenminister Guido Westerwelle gegen ihre Mitgliedschaft im Stiftungsrat sein Veto eingelegt – mit dem Argument, ihre Teilnahme könne sich aufgrund einiger politischer Positionen, die sie in der Vergangenheit und in der Gegenwart vertreten habe, negativ auf die deutsch-polnischen Beziehungen auswirken.
DM: Warum wurde dieses Projekt so kontrovers wahrgenommen?
MK: Das Problem berührt die Frage, wie die Erinnerung an die 14 Millionen Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in beide Teile Deutschlands integriert werden mussten, gepflegt werden kann, ohne damit deutsch-polnische oder deutsch-tschechische Diskussionen hervorzurufen, die den Prozess der Versöhnung beinträchtigen könnten.
DM: Wollen Sie einen Teil der deutschen Geschichte, der Ihrer Meinung nach vergessen wurde, wieder beleben?
MK: Ja. Viele Jahre lang wurde das Thema „Flucht und Vertreibung“ in der deutschen Erinnerungskultur kaum wahrgenommen. Erst jetzt kommen die Fragen auf: „Wie sollen wir mit diesem Thema umgehen?“ und „In wie weit ist es möglich, diesen Teil der deutschen Geschichte mit der allgemeinen Geschichte der Vertreibungen im 20. Jahrhundert zu verbinden?“ Die Vertreibung der Deutschen hätte ohne die vorherigen Taten der Nationalsozialisten sicher nicht stattgefunden. Doch die Millionen von Deutschen, die vertrieben wurden, sind ebenfalls Opfer. 12 bis 14 Millionen vertriebener Menschen, von denen die meisten Frauen oder Kinder waren, die wenig oder keinen Einfluss auf die Politik des Dritten Reiches hatten – schon gar nicht auf der höheren Ebene. Aber es gab 1945 keine Kriterien, um zwischen Nazis zu unterscheiden, die Tschechen, Polen oder Juden ermordet hatten, und all den vielen anderen Deutschen, die aber ebenfalls aus Schlesien, Pommern oder der Tschechoslowakei vertrieben wurden. Es war vielmehr eine kollektive Bestrafung all jener, die man als Deutsche identifizierte. Deshalb waren ja etwa auch die deutschen „Anti-Faschisten“ in der Tschechoslowakei von dem Prozess der Vertreibung betroffen.
DM: Was denken Sie, warum wurde das Thema gemieden?
MK: Es ist ein schwieriges Thema. Es verlangt die Erinnerung an deutsche Opfer, steht aber gleichzeitig im Kontext der Erinnerung an deutsche Täter, was kein einfaches Unterfangen ist. So gab es Befürchtungen, dass die Erinnerung an die Vertreibung das Geschichtsbild soweit verändern könne, dass die Deutschen plötzlich vorwiegend als Opfer des Zweiten Weltkrieges angesehen würden. Es gab auch die Befürchtung, dass die Verbrechen des Dritten Reiches nach dem Motto relativiert werden könnten: „Ja, ja, alles richtig, aber wir Deutschen sind später auch Opfer gewesen“. Wir sind dennoch überzeugt, mit dem Thema verantwortungsvoll umgehen zu können.
DM: Stimmen Sie der Aussage zu, dass Sie in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts neue Schwerpunkte setzen?
MK: Nein, dem stimme ich nicht zu. Es reicht schon, nur einen Blick auf die Rechtsgrundlage zu werfen, auf der unsere Stiftung etabliert wurde: „Zweck der Stiftung ist es, die Erinnerungen und das Gedenken an Flucht und Vertreibung im zwanzigsten Jahrhundert im historischen Kontext des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik und ihrer Folgen wach zu halten.“ Das ist der Stiftungszweck, Absatz 1. Man kann also sicherlich nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen...
DM: Doch dies behaupten Ihre Feinde?
MK: Genau.
DM: Was ist Ihrer Meinung nach die Quelle aller Missverständnisse, die das Projekt umgeben?
Michael Dorrmann: Ein Grund ist, dass wir ständig mit dem Zentrum gegen Vertreibungen verwechselt werden, vor allem in Polen. Vor allem die Bevölkerung – weniger die Politik – unterscheidet nicht zwischen unserer Bundesinstitution und dem Zentrum. Und wie Sie wissen, ist der Bund der Vertriebenen eine Organisation mit vielen Mitgliedern, von denen einige historisch-politische Ansichten vertreten, die in Polen und Tschechien auf Unverständnis stoßen.
MK: In den 1970ern war der Bund der Vertriebenen ein vehementer Gegner der so genannten Ostverträge – des Warschauer Vertrages, des Prager Vertrages, der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie. Deswegen gibt es in einigen osteuropäischen Ländern immer noch feindliche Reaktionen auf den Terminus „Bund der Vertriebenen“. Doch diese Sichtweise ist einseitig, denn viele Mitglieder des Bundes der Vertriebenen reisen schon seit längerer Zeit immer wieder nach Polen und Tschechien, um beim Aufbau ihrer früheren Heimatregionen zu helfen, so zum Beispiel Herbert Hupka, der bekannte Vize-Präsident des Bundes der Vertriebenen seit den 1970er Jahren. Über ihn sagte man zu Kindern in Polen, wenn sie ihre Suppe nicht brav aufaßen, sinngemäß: Pass nur auf, dass nicht der Hupka kommt und dich auffrisst. Eben dieser Herbert Hupka ist in den 1990ern Ehrenbürger seiner ehemaligen Heimatstadt in Schlesien geworden. Er hatte die Kommune zum Beispiel bei der Antragstellung für Gelder zum Bau einer Kläranlage unterstützt.
MD: Es ist manchmal nicht einfach für die Bevölkerung in Polen und in der Tschechischen Republik, sich an diesen Teil der Geschichte zu erinnern. Denn die Vertreibung der Deutschen ist ein schwieriger und gewaltsamer Teil ihrer Geschichte.
MK: Und für eine lange Zeit gab es eine Tendenz in der polnischen und tschechischen Gesellschaft zu sagen: Es waren Churchill, Roosevelt und Stalin, die über die Politik der Vertreibung in Potsdam 1945 entschieden haben; wir dagegen sind nur eine kleine Nation und hatten diese Politik einfach nur zu exekutieren. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit.
DM: Sind Sie der Meinung, dass die Stiftung Teil einer neuen Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer Geschichte ist, die nach der Wiedervereinigung begonnen hat?
MK: Ja, dem würde ich zustimmen. Es hat in Deutschland, aber auch im übrigen Europa nach 1990 einen Diskussionsschub darüber gegeben, wie wir mit unserer jüngsten Vergangenheit umgehen sollen. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Osteuropäer offensichtlich Opfer zweier Diktaturen waren, nicht nur der Diktatur der Nationalsozialisten, sondern auch der Sowjetunion Stalins.
DM: Denken Sie, dass die Stiftung im Kontext einer neuen deutschen Machtmentalität betrachtet werden kann?
MK: Für mich ist das eine etwas abseitige Diskussion. In Anbetracht der eher fragilen nationalen Identität oder der vor kurzem abgeschafften Wehrpflicht oder der bekannten demographischen Entwicklung, kann ich nicht recht nachvollziehen, wie man heutzutage Angst vor diesem Deutschland haben kann.
DM: Aber Sie begrüßen es, dass sobald man über die Gebiete mit einer deutschsprachigen Bevölkerung spricht, man über die Geschichte eines deutschsprachigen Volkes berichtet.
MD: Wenn Sie auf solche Regionen wie Bessarabien oder Rumänien schauen, so werden Sie feststellen, dass es dort nicht nur deutsche, sondern auch jüdische und ukrainische Minderheiten gab. Andere Gegenden, wie Niederschlesien waren ausschließlich Deutsch, doch Städte wie Czernowitz hatten eine sehr gemischte Bevölkerung. Eine Aufgabe unserer Stiftung ist es also, Europa als Ganzes in den Blick zu nehmen und dabei klar zu machen, dass es in vielen Gegenden eine sehr gemischte Bevölkerung gab und diese Realität und die damit verbundenen Konflikte aufzuzeigen...
MK: Wir leben in Gesellschaften, die aufgrund der Immigration immer bunter werden, mit allen Chancen und Risiken die das mit sich bringt, sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern. Wenn man also die vergangenen Konflikte betrachtet, aber auch das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien in der Vergangenheit, dann kann das sehr aufschlussreich sein, um daraus hinsichtlich der heutigen integrationspolitischen Herausforderungen zu lernen.
DM: Eine Feststellung kann man aus Ihrer Arbeit ableiten: Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland.
MK: Es war in seiner Geschichte beides, Ein- und Auswanderungsland. Im Mittelalter sind viele Deutsche nach Osten gewandert, im 19. Jahrhundert dann viele Richtung USA.
MD: Das zieht sich durch die gesamte europäische Geschichte: Menschen, die immigrieren und emigrieren, manchmal aufgrund von Gewalt.
DM: Möchten Sie noch etwas ergänzen?
MK: Vielleicht nur noch, dass unsere Motivation zur Kooperation mit der Berlin Biennale auch darin bestand, letzte Vorurteile und Missverständnisse gegenüber unserem Projekt auszuräumen. Es war uns wichtig, die Intention zu verdeutlichen, die hinter unserer Arbeit steht: Ein möglichst objektives Bild des 20. Jahrhunderts und der Problematik der Zwangsmigration im 20. Jahrhundert zu vermitteln.


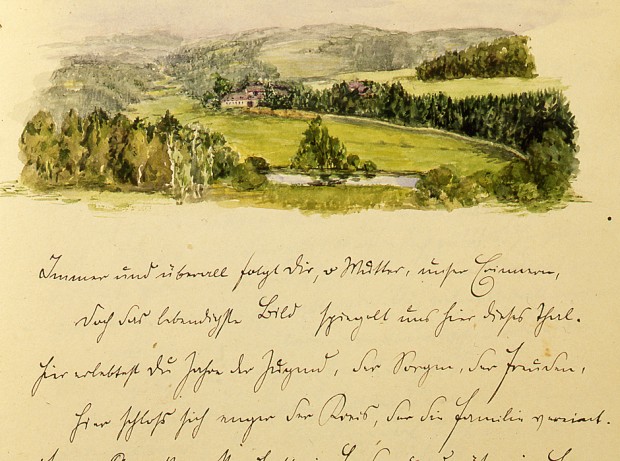

On Twitter
Keine Kommentare / Kommentar schreiben